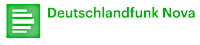Tanguieta (epo). - Von der Kreisstadt Tanguieta im Norden Benins aus führt die fast schnurgerade Piste in Richtung Nationalpark. Jetzt, zum Ende der Regenzeit ist alles fantastisch grün und die Felder der Bauern sind gut zu erkennen. Links dehnt sich das sanft zum Pendjari-Fluss hin abfallende Schutzgebiet aus, während sich rechterhand die Atakora-Bergkette wie der Rücken eines urzeitlichen Fossils erstreckt. Und doch ist dies noch nicht der eigentliche Nationalpark. Südlich der Schutzzone wurde die 'Zone kontrollierter Okkupation' ausgewiesen, in der Landwirtschaft und auch kontrollierte Jagd erlaubt sind. Was manchem eingefleischten Naturschützer einen Schauer über den Rücken jagen dürfte, könnte sich hier draußen jedoch als Schlüssel für eine nachhaltige und erfolgreiche Verwaltung des Gebiets erweisen. Eine Reportage von Uwe Kerkow.
Tanguieta (epo). - Von der Kreisstadt Tanguieta im Norden Benins aus führt die fast schnurgerade Piste in Richtung Nationalpark. Jetzt, zum Ende der Regenzeit ist alles fantastisch grün und die Felder der Bauern sind gut zu erkennen. Links dehnt sich das sanft zum Pendjari-Fluss hin abfallende Schutzgebiet aus, während sich rechterhand die Atakora-Bergkette wie der Rücken eines urzeitlichen Fossils erstreckt. Und doch ist dies noch nicht der eigentliche Nationalpark. Südlich der Schutzzone wurde die 'Zone kontrollierter Okkupation' ausgewiesen, in der Landwirtschaft und auch kontrollierte Jagd erlaubt sind. Was manchem eingefleischten Naturschützer einen Schauer über den Rücken jagen dürfte, könnte sich hier draußen jedoch als Schlüssel für eine nachhaltige und erfolgreiche Verwaltung des Gebiets erweisen. Eine Reportage von Uwe Kerkow. Der Wilderer wirkt überhaupt nicht zerknirscht, sondern unbeugsam und sogar etwas arrogant. Dabei hat er eigentlich keinen Grund dazu. Denn es scheint erwiesen, dass er im Nationalpark Pendjari Elefanten geschossen hat. Sollte sich das Gericht in der Distrikthauptstadt Natitingou im Norden Benins dieser Auffassung anschließen, droht dem Mann eine mehrmonatige Haftstrafe. Entsprechend verhöhnen ihn die Wildhüter, die ihn vorläufig in eines der zum Projekt gehörenden Gebäude gesperrt haben.
Hinweise aus der Bevölkerung haben zu seiner Verhaftung geführt und es den Rangern außerdem möglich gemacht, das Lager des Wilderers mit einigen Stoßzähnen auszuheben. "Ich kenne den Mann und habe ihm vor einiger Zeit sogar einen Job als Fährtenleser angeboten", erzählt Udo Lange, der die Verwaltung des Pendjari Nationalparks im Nordwesten von Benin im Auftrag der GTZ berät. "Damals hat er abgelehnt, weil ihm die Bezahlung wohl nicht reichte....". So unerfreulich das Ganze ist, zeigt es nach Meinung von Lange zumindest, dass das neue Konzept des Pendjari-Projektes funktioniert und die Bevölkerung beginnt, sich mit dem Naturschutzgebiet vor ihrer Haustür zu identifizieren.

Frank Bremer, Mitarbeiter der GTZ, der die beninischen Behörden in Cotonou in Sachen Pendjari-Nationalpark berät, sieht das ähnlich: "Wir wollen ein vernünftiges Überwachungssystem und eine ausreichende Infrastruktur für den Park sowie die angrenzenden Schutzzonen aufbauen, aber auch eine funktionierende Verwaltung auf den Weg bringen helfen", erklärt er. "Das geht nur mit und keinesfalls gegen die Bevölkerung, wenn der Schutz des Parks nachhaltig sein und auch nach Beendigung des Projekts funktionieren soll." Deshalb wurde die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung zum "strategischen Schwerpunkt" des gesamten Vorhabens, wie Bremer es formuliert.
Wanderfeldbau und Buschfeuer
Denn fast alle Probleme, die die Projektmitarbeiter vor Ort derzeit beschäftigen, sind direkt auf menschliche Eingriffe zurück zu führen. Neben der Wilderei macht ihnen vor allem die Landwirtschaft und hier insbesondere die Baumwollkulturen Sorge. Baumwolle ist der einzige Exportartikel, den Benin auf den Weltmärkten in nennenswertem Umfang anbieten kann, und ihr Anbau wird vom Staat stark gefördert. Der hohe Flächenverbrauch durch den Wanderfeldbau aber auch der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden schaden dem größten Savannen- Ökosystem in Westafrika erheblich. Auch die Buschfeuer, die immer wieder von den Dörflern gelegt werden, tragen zur Degradation der natürlichen Umwelt bei.
Doch mit Verboten lässt sich nichts erreichen. Und die Menschen, die an der Grenze zum Schutzgebiet leben, haben keine andere Möglichkeit anderswo Landwirtschaft zu betreiben: Im Rücken der Ansiedlungen an der Straße erhebt sich die Atakora, eine Hügelkette, die - obwohl nicht besonders hoch - eine landwirtschaftliche Nutzung schwierig macht. Deshalb haben die Projektmitarbeiter vor der letzten Regenzeit gemeinsam mit den Bewohnern der Dörfer in einem ersten Schritt einen zwei bis drei Kilometer breiten Streifen ausgemessen, in dem Ackerbau jetzt ausdrücklich erlaubt ist - die sogenannte 'Zone kontrollierter Nutzung'. Im Gegenzug haben sich die Dörfler verpflichtet, nur noch in diesem Streifen zu roden.
Um auf diesen ausgewiesenen Flächen ausreichende Erträge zu ermöglichen, unterstützt das Projekt Maßnahmen, die die Erträge verbessern helfen sollen. Außerdem möchte man die Bauern dazu ermutigen, den Baumwollanbau aufzugeben. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt das Projekt ein ganzes Bündel von Maßnahmen im Bereich ländlicher Entwicklung. Das beginnt bei der Förderung von einkommensschaffenden Aktivitäten wie zum Beispiel der Weiterverarbeitung von Erdnüssen zu Öl und gemischt mit Sorghum-Mehl zu Keksen und der Gewinnung von Pulver aus den Früchten des Baobabs für Instant-Getränke oder der Bienenhege.
Bauern werden unterstützt
Hiervon profitieren vor allem die Frauen. Unterstützt werden auch alle Initiativen der Bauern, die zu einer nachhaltigen Intensivierung des Feldbaus beitragen: bodenverbessernde Maßnahmen, Zwischenfruchtfeldbau und nicht zuletzt die Anschaffung von Zugtieren und Geräten für die Bodenbestellung. Dies wird - wie alle Maßnahmen der ländlichen Entwicklung - durch Lehrgänge ergänzt. Denn bisher haben nur wenige Bauern ihre Felder gepflügt und der Wanderhackbau ist nach wie vor die dominierende Form der Feldbestellung. Schließlich wird die Tierhaltung und die Fischerei gefördert, sowie unter anderem Getreidebanken geplant. So sollen die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln auch in der langen Trockenzeit sicher gestellt werden und die Unabhängigkeit von Wucherern, bei denen sich die Bauern immer wieder verschulden. Alle Maßnahmen werden durch einen Fonds für revolvierende Kredite finanziert - nicht durch Zuschüsse.
Darüber hinaus hat man die Zone der kontrollierten Okkupation hydrogeologisch untersuchen lassen und eine Reihe von Senken (bas-fonds) gefunden, in denen nach einfachen Ausbaumaßnahmen der Anbau von Reis möglich ist. In der Atacora ist Reis kein Grundnahrungsmittel, sondern ein Luxusartikel, für den auf den lokalen Märkten Bargeld bekommt. Die Projektmitarbeiter hoffen, dass der Reisanbau die Baumwolle verdrängen kann. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Bauern sich gegen die billigen Importe aus Asien behaupten können.
Von der Kreisstadt Tanguieta aus führt die fast schnurgerade Piste in Richtung Nationalpark. Jetzt, zum Ende der Regenzeit ist alles fantastisch grün und die Felder der Bauern sind gut zu erkennen. Links dehnt sich das sanft zum Pendjari-Fluss hin abfallende Schutzgebiet aus, während sich rechterhand die Atakora wie der Rücken eines urzeitlichen Fossils erstreckt. "Dies ist noch nicht der eigentliche Nationalpark", erinnert Udo Lange. "Wir fahren jetzt an der südlichen der beiden Schutzzonen entlang, in denen nicht nur die Zone kontrollierter Okkupation ausgewiesen wurde, sondern auch kontrollierte Jagd erlaubt ist." Was dem eingefleischten Naturschützer einen Schauer durch den Rücken jagen dürfte, könnte sich hier draußen jedoch als Schlüssel für eine nachhaltige und erfolgreiche Verwaltung des Gebiets erweisen.
Besichtigungstourismus findet zwar statt, ist aber mit 6000 Besuchern pro Saison derzeit noch nicht voll entwickelt und trägt nur zu einem Viertel zu den Einnahmen aus dem Nationalpark bei. Konzepte für Ökotourismus ecxistieren und müssen noch umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem um Produkte für neue Kundengruppen wie Ornithologen oder Wandertouristen, die zu Fuß durch den Pak wollen.. Die Jagdlizenzen und die Abschussprämien, die Jagdtouristen zahlen, bringen dagegen deutlich mehr als die Hälfte aller Einnahmen. Die beliefen sich für die Saison zwischen dem 15. Dezember 2000 und dem 30. April 2001 insgesamt auf immerhin rund 120.000 Euro, denen jedoch Ausgaben von fast 360.000 Euro gegenüber stehen. Natürlich dürfen keine Elefanten und Geparden getötet werden - letztere sind schließlich das Wappentier des Parks. Aber für verschiedene Antilopenarten und sogar für Löwen und Nilpferde werden jährlich Abschusszahlen festgelegt.
In Tanougou, dem ersten größeren Dorf an der Strecke sprechen wir mit dem Dorfältesten. Bertin Tankouanou ist ein bedächtiger und überlegter Mann, der gut Französisch spricht; kein ärmlicher Bittsteller. Die Regenzeit habe spät und dann sehr heftig eingesetzt, berichtet er. Dadurch habe man teilweise zweimal säen müssen. Jetzt entwickelten sich die Feldfrüchte aber recht ordentlich. Dann referiert er über die Notwendigkeit, die Erträge zu steigern, da - anders als früher - nicht mehr genug Land für alle vorhanden sei. "Schon jetzt gibt es Dörfer, die keine Flächen mehr in Reserve haben, aber unsere Bevölkerung wächst weiter", gibt Tankouanou zu bedenken. Doch Dünger sei teuer und es gebe keine Unterstützung von staatlicher Seite. "Das Geld, das der Park einbringt, wollen wir sparen, bis wir eine eigene Schule bauen können", betont er.
Die landwirtschaftliche Komponente ist nämlich nur ein Teil der Projektstrategie vor Ort. Für ebenso wichtig halten es die Verantwortlichen, die Anrainer an der Nutzung der natürlichen Ressourcen zu beteiligen. Daher wurde den umliegenden Dörfern nicht nur erlaubt, wieder in gewissem Umfang zu jagen. Wirklich richtungsweisend ist der Beschluss, die Bevölkerung vor Ort an den Einnahmen zu beteiligen, die der Nationalpark und die angrenzenden Jagdzonen abwerfen - und zwar zu 30 Prozent.
Anwohner an Einnahmen beteiligt
Um diese Gelder zu verwalten und zu verteilen, aber auch um gegenüber den staatlichen Stellen über eine Vertretung zu verfügen, haben die Dörfer auf Initiative des Projektes die AVIGREV gegründet. Das Akronym steht für 'Vereinigung der Dörfer zum Management des Wildbestandes' (Association Villageoise de Gestion des R?serve Faunique). Der Verein, erhebt eine Beitrittsgebühr und jährliche Mitgliedbeiträge. Von den Einkünften aus dem Nationalpark und den Jagdzonen darf die AVIGREF nur 10 Prozent für die eigene Finanzierung zurück halten. Der Rest soll in Abstimmung mit den Entwicklungskomitees der einzelnen Dörfer für lokale Zwecke verwendet werden. Auch Tankouanou ist natürlich Mitglied bei der AVIGREF und vertritt hier die Interessen seines Dorfes.
Welche Aufgaben die Organisation in Zukunft übernehmen kann und wird, steht noch nicht in allen Einzelheiten fest. Doch soll sie Parkverwaltung beim Management der Jagdzonen unterstützen und dabei möglichst autonom agieren. Das soll zunächst mit der selbstständigen Ausrichtung von Dorfjagden und der Unterstützung von Projektaktivitäten beginnen. Später könnten die Dörfer die Pachtbedingungen vielleicht direkt mit den Jagdpächtern aushandeln und im Gegenzug die Infrastruktur in den Jagdzonen instandhalten sowei die Überwachung sichern.
"Die Beteiligung der Anrainer an den Einnahmen verschlechtert kurzfristig zwar erst einmal die Bilanz", meint Frank Bremer, sieht jedoch noch eine ganze Menge Reserven. "Um mindestens 20 Prozent können wir die Einnahmen aus dem Jagdgeschäft steigern, indem wir die Preise anheben". Und auch Besucherzahlen von 10.000 Touristen im Jahr könne der Park problemlos verkraften. Das Management und die Überwachung sei bereits modernisiert worden. Da die Wildhüter jetzt mit GPS ausgerüstet seien, könne man ihre tatsächliche Leistung ermitteln und leistungsabhängig vergüten. So habe man das Personal verringern können und gleichzeitig die Effizienz erhöht.
"Jetzt müssen wir noch an die Verwaltungskosten in Cotonou ran", fügt er abschließend hinzu. Vor Projektbeginn habe man als vertauensbildende Maßnahme nicht nur das gesamte Parkpersonal auswechseln müssen. Bereits vor Beginn des Pendjari-Projektes wurde auf Druck der Geber das CENAGREF 'Nationales Zentrum zum Management des Wildbestandes' (Centre National de Gestion des R?serves Fauniques) gegründet, das in Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten autonom ist. "Im Verwaltungsrat der Behörde ist auch ein Vertreter der AVIGREV Mitglied, das unter anderem darüber wacht, dass den Dörfern die vereinbarten 30 Prozent der Einnahmen auch tatsächlich ordnungsgemäß ausgezahlt werden", betont Bremer.
Wahrscheinlich wird sich Der Pendjari-Nationalpark jedoch nie vollständig finanzieren können. Um die Nachhaltigkeit des Projekts dennoch zu gewährleisten, ist an die Gründung eines Trust-Funds gedacht. Mögliche Partner sind die 'Globale Umweltfazilität' (GEF), bilaterale Geber und der beninische Staat. Gesucht werden aber auch Privatfirmen - etwa aus der Pharma- oder Tourismusbranche - die bereit sind, sich finanziell an der Erhaltung der Savannenlandschaft zu beteiligen, um mit ihrem Engagement Werbung zu treiben.
Langfristige Perspektive
"Trotz der starken Entwicklungskomponente bleibt das Projekt natürlich in erster Linie dem Naturschutz verpflichtet", erinnert Djafarou Ali Tiomoko, der Direktor des Nationalparks. Die wichtigsten Geldgeber seien die GTZ und die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die vor allem die Kosten für die Errichtung der neuen Infrastruktur trage. Diese Mittel seien allerdings verspätet eingetroffen, so dass mit der Erneuerung des Pistennetzes erst jetzt begonnen werden könne. Zum Glück habe die GTZ zum Beispiel die GPS-Technik vorfinanziert - sonst hätte man überhaupt noch nicht richtig anfangen können. Darüber hinaus beteilige sich auch die GEF an dem Vorhaben. "Die biologische Vielfalt der Ökosysteme im Pendjari-Nationalpark ist mit der in den großen Parks Ostafrikas durchaus vergleichbar", betont er.
Auch Tiomoko unterstreicht, wie wichtig es ist, die Bevölkerung zur Zusammenarbeit zu bewegen. "Ich denke in einem Rahmen von vielleicht 15 bis 20 Jahren", sagt er. So lange wird es seiner Meinung nach dauern, bis die Bevölkerung ihre neue Verantwortung erkannt hat und in vollem Umfang an der Verwaltung des Parks und der Jagdzonen mitarbeitet. "Doch dann kann sich die Parkverwaltung vielleicht sogar ganz aus dem Management der Jagdzonen zurückziehen", hofft er. "Dann brauchen wir nur noch einige wissenschaftlichen Mitarbeiter, die die ökologischen Parameter überwachen um die Abschusszahlen festzulegen oder die Bevölkerung beim Management der Buschfeuer zu beraten."
Uwe Kerkow
Fotos: Uwe Kerkow