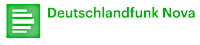Berlin. - FIAN und INKOTA haben eine Studie zur immer engeren Verquickung von staatlicher Entwicklungszusammenarbeit mit Finanzinvestoren und Agrarkonzernen veröffentlicht. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der wachsende Einsatz privater Gelder nicht geeignet sei, um Hunger und Armut strukturell zu bekämpfen.
Die Autoren der Studie "Agrarkonzerne und Finanzindustrie: Die neuen Lieblinge der Entwicklungszusammenarbeit?" widersprechen der Aussage, wonach nur mit Investitionen des Privatsektors die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) erreicht werden können. Sie kritisieren, dass das Entwicklungsministerium mit seinem Schwerpunkt auf Privatinvestitionen die eigentlichen Zielgruppen – marginalisierte Bevölkerungsgruppen – aus dem Blick verliere. Da es meist keine Informationen über die finalen EmpfängerInnen der Gelder gebe, seien konkrete menschenrechtliche Wirkungen in der Regel unbekannt.
Roman Herre, Agrarreferent von FIAN Deutschland und Ko-Autor der Studie, erklärte: "Im Gepäck der SDGs war die Botschaft enthalten, dass zu ihrer Umsetzung gewaltige 2,5 Billionen Dollar pro Jahr fehlen – und nur privates Geld dieses Loch stopfen könne. Diese Botschaft wird nicht hinterfragt. Sie führte zur Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit und hat damit möglicherweise mehr Wirkkraft entfaltet als die Entwicklungsziele selbst."
Ein konkreter Aspekt, der von den Autoren kritisch betrachtet wird, ist die zunehmende Kooperation mit Agrarkonzernen, mit der die Landwirtschaft – vor allem auf dem afrikanischen Kontinent – zu marktförmigen und inputintensiven Systemen umstrukturiert werden solle. Diese Kooperation werde im Rahmen einer Vielzahl von Initiativen realisiert, darunter die Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika (AGRA) oder die Neue Allianz für Ernährungssicherung der G7-Staaten.
"Initiativen wie AGRA setzen vor allem auf den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Hybridsaatgut und dienen damit in erster Linie den Expansionsbestrebungen großer Konzerne wie Yara und Bayer", sagte Lena Michelsen, Agrarreferentin von der Entwicklungsorganisation INKOTA. "Kleinbauern und -bäuerinnen geraten in immer stärkere Abhängigkeiten, und auch die Umwelt leidet unter dem längst gescheiterten Modell der Grünen Revolution. Die von der Bundesregierung zugesagte Förderung in Höhe von zehn Millionen Euro ist eine völlige Fehlinvestition."
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die "Intransparenz der Finanzinstitutionen". Allein die DEG, Tochter der staatlichen Entwicklungsbank KfW, habe mehr als die Hälfte ihrer 7,2 Milliarden Euro Entwicklungsgelder an Finanzinstitute vergeben. Auch hätten sich Kredite und Beteiligungen der DEG an Unternehmen in Finanzoasen – darunter den Kaimaninseln oder Mauritius – innerhalb von zehn Jahren verfünffacht. Zur Legitimierung solcher Konstrukte würden oft fragwürdige Kennzahlen und indirekte Wirkungen herangezogen. So erkläre die DEG in ihrem jüngsten Jahresabschluss, dass "DEG-Kunden rund 1,5 Millionen Menschen beschäftigen".
"Aus entwicklungspolitischer und menschenrechtlicher Perspektive müsste untersucht werden, ob durch solche Finanzierungen auch Arbeitsplätze abgebaut wurden", betonte Roman Herre von FIAN. "Dies ist besonders bei Agrarfinanzierungen im globalen Süden ein bedeutender Aspekt: Die dortige kleinbäuerliche Landwirtschaft beschäftigt je nach Region 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung. Werden Menschen hieraus verdrängt – wie besonders bei großflächigen Agrarinvestitionen – dann verlieren sie oftmals ihre Lebensgrundlagen."
Quelle: www.fian.de