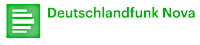Von Uwe Kerkow Jos/Nigeria (epo). - Ruhig liegt der compound des Hauptsitzes der Evangelischen Kirche Westafrikas (Evangelic Church of West Africa, ECWA) in der Morgensonne von Jos in Zentralnigeria. In der vorherigen Nacht hat es ausgiebig geregnet, und das lässt auf einen schönen Tag hoffen. Die Anlage ist für westafrikanische Verhältnisse weder besonders groß, noch sind die Gebäude darauf ausgelegt, die Besucher zu beeindrucken. Auch der Fuhrpark lässt nicht darauf schließen, dass von hier aus rund 2000 Gemeinden mit über zwei Millionen Gläubigen und die größte evangelische Mission Nigerias mit über 600 Missionaren betreut werden.
Jos/Nigeria (epo). - Ruhig liegt der compound des Hauptsitzes der Evangelischen Kirche Westafrikas (Evangelic Church of West Africa, ECWA) in der Morgensonne von Jos in Zentralnigeria. In der vorherigen Nacht hat es ausgiebig geregnet, und das lässt auf einen schönen Tag hoffen. Die Anlage ist für westafrikanische Verhältnisse weder besonders groß, noch sind die Gebäude darauf ausgelegt, die Besucher zu beeindrucken. Auch der Fuhrpark lässt nicht darauf schließen, dass von hier aus rund 2000 Gemeinden mit über zwei Millionen Gläubigen und die größte evangelische Mission Nigerias mit über 600 Missionaren betreut werden.
Was man den Gebäuden ebenfalls nicht ansieht, ist das Alter der Kirche: ECWA ist schon 1893 aus der Sudan Interior Mission hervorgegangen, wie Reverend Gordian M. Okezie, der Stellvertretende Generalsekretär, betont. ECWA ist vor allem in Zentralnigeria - im so genanten Middle Belt - verbreitet, aber auch große Gemeinden in im überwiegend muslimisch geprägten Norden gehören dazu. "Wir missionieren nicht nur in Nigeria", berichtet Okezie mit einem gewissen Stolz, "sondern auch in Togo, Kamerun, dem Tschad und im Niger". Aktiv ist ECWA aber auch in der afrikanischen Diaspora in den USA und in Großbritannien.
Von ihren entwicklungspolitischen Aktivitäten hat sich die Kirche Mitte der 80er Jahre organisatorisch getrennt. Zunächst wurde eine Firma gegründet, die landwirtschaftlichen Bedarf vertreibt und tierärztliche Dienste anbietet. Auch eine Apotheke und eine große Klinik in Jos gehören ECWA. "In die Klinik kommen mehr Muslime als Christen", streicht Okezie heraus. Zudem habe man dort eine Station aufgebaut, die speziell junge muslimische Frauen versorge. "Viele von ihnen müssen zu früh heiraten und Kinder kriegen", erklärt Okezie die Situation. Oft komme es in Folge dessen zu gesundheitlichen Problemen, die in Jos nur auf dieser Station behandelt werden können.

In dem weitläufigen Krankenhausgelände befinden sich auch die Gebäude der Abteilung für Entwicklungspolitik von ECWA (People Oriented Development, POD). Istifanus Gimba, der Direktor des 1984 gegründeten POD und sein Team von fünf Mitarbeitenden sind deutlich jünger als seine Vorgesetzten. Alle strahlen eine konzentrierte Professionalität aus. "In Nigeria sind wir in insgesamt 62 Landkreisen tätig, die im Zentrum und im Norden des Landes konzentriert sind", sagt Gimba. "Ein neues Projekt initiieren wir nur dann, wenn keine Nichtregierungsorganisation vor Ort ist, die den Job besser erledigen könnte als wir und wenn sicher gestellt ist, dass wir unsere Zielgruppe, unterprivilegierte Arme auf dem Lande, auch tatsächlich erreichen." Gimba legt in diesem Zusammenhang Wert darauf, dass die Zugehörigkeit zum christlichen Glaubensbekenntnis in den meisten Projektregionen von ECWA ausreicht, um von der muslimischen Mehrheit benachteiligt zu werden.
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MIT ALLEN
Deshalb habe man die entwicklungspolitische Arbeit in letzter Zeit auch erheblich erweitert. "Wir verfügen mittlerweile über mehrjährig angelegte Strategieplanung und dehnen unsere Aktivitäten im Moment auf Advocacy, Empowernment und staatsbürgerliche Erwachsenenbildung aus", berichtet Gimba. So wollen die Mitarbeiter des POD-Programms von ECWA die junge Demokratie Nigerias festigen helfen. Natürlich verfolge man die bisherigen Aktivitäten in den Bereichen Basisgesundheit, Grundbildung, Trinkwasserversorgung sowie einer grundlegenden sanitären Versorgung und überschaubaren Infrastrukturprojekten weiter.
"Unsere Arbeit wird von den Muslimen als Engagement von Christen wahrgenommen und kritisch oder sogar argwöhnisch beobachtet", gibt Gimba zu. "Doch in der Regel öffnen sich die Muslime, wenn klar wird, dass es keine religiöse Diskriminierung gibt und alle partizipieren können." Wichtig sei es darüber hinaus, die lokalen traditionellen Führer (chiefs) zur Zusammenarbeit zu bewegen. "Aber wir achten nicht nur darauf, dass alle Bevölkerungsgruppen in den Genuss der Vorteile gelangen, die aus unseren Projekten entstehen. Genau so großen Wert legen wir darauf, dass die Dörfler mit anpacken", so Gimba. Es werde nicht einfach etwas verschenkt und auch Bargeld gebe es entgegen den Wünschen der meisten Menschen nicht.

"Wenn wir zum Beispiel helfen, eine Grundschule zu errichten, muss die Dorfgemeinschaft den Rohbau und den Dachstuhl errichten." POD steuere dann die Dinge bei, die bezahlt werden müssten und die die Bauern sich nicht leisten können: Die Wellbleche für das Dach und Türen, Fenster oder die Sitzbänke. "Außerdem prüfen wir genau, ob die zuständigen Regierungsstellen ihre Zusagen erfüllen." Meist gehe es dabei darum, die Planstelle für den neuen Lehrer auch wirklich zu besetzen - keine Selbstverständlichkeit in Nigeria.
Über eine breite Palette von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen verfügt auch die Kirche Christi in Nigeria (Church of Christ in Nigeria, COCIN) auf dem Jos Plateau. COCIN wird dieses Jahr genau 100 Jahre alt und zählt etwa fünf Millionen Kirchenglieder, von denen sehr viele in Jos und Umgebung leben. In der Mehrzahl der Dörfer auf dem Plateau stehen Hinweisschilder auf COCIN-Aktivitäten.
Obadiak K. Gutip, der Direktor der Bildungsabteilung von COCIN, verweist mit Stolz darauf, dass das Bildungsangebot der Kirche nahezu vollständig ist: Primar- und Sekundarschulen werden durch eine Behindertenschule in Mangu ergänzt und eine Blindenschule und sowie eine wichtige weiterführende Schule in Gindiri. Und Gutip hat große Pläne: "In Gindiri besteht seit 1934 ein theologische Seminar, wo in Haussa gelehrt wird", berichtet er. "Nun planen wir die Gründung einer Universität, innerhalb derer das theologische Seminar als ordentliche Fakultät weiter geführt wird." Die Universität soll zunächst etwa 100 Studenten aufnehmen - später vielleicht doppelt so viele.
Gutip bekräftigt, dass auch rein christliche Bildungseinrichtungen allen Glaubensrichtungen offen stehen. Die Schulen sind Privatschulen, deren Besuch erheblich teurer ist als der einer öffentlichen Schule. Allerdings ist das Ausbildungsniveau auch weit höher. Muslimische Kinder können diese Schulen problemlos besuchen, solange sie ihren Glauben nicht innerhalb des Schulgeländes praktizieren und an dem Morgengebeten und den Gottesdiensten teilnehmen. Da Schuluniformen getragen werden, spielen religiöse Kleidervorschriften keine Rolle. Viele gebildete und entsprechend wohlhabende Eltern muslimischen Glaubens nutzen diese Möglichkeit: Tagsüber schicken sie ihre Kinder in die christliche Schule und abends in die Koranschule.

Stärkere Verwerfungen als im Bildungsbereich sind im Gesundheitswesen zu beobachten. Bevor er auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommt, wartet auch Viljap Abraham, der Öffentlichkeitsreferent von COCIN, zunächst mit Zahlen auf: "Wir beschäftigen 400 Menschen im Gesundheitswesen, betreiben vier Krankenhäuser, 120 Basisgesundheitsstationen und 30 mobile Kliniken", zählt er auf. Hier ist es genau umgekehrt wie beim Schulgesuch: Wer sich in einer christlich geführten Gesundheitsstation versorgen lässt, zahlt weniger als bei einer staatlichen Einrichtung.
Dennoch nutzen viele Muslime, aber auch die Anhänger verschiedener christlicher Konfessionen, die Angebote nicht oder nur unzureichend. "Da sind zum einen die Pfingstler, die die medizinische Versorgung prinzipiell ablehnen", erläutert Abraham. Aber auch die Katholiken verweigerten sich der Familienplanung und teilweise auch der reproduktiven Gesundheitsfürsorge. "Doch das Hauptproblem sind unsere muslimischen Mitbürger", hebt Abraham hervor. Seit der Einführung der Sharia sei es ihnen im Prinzip verboten, christlich gemanagte Gesundheitsdienstleistungen anzunehmen. Diese Vorschrift greift vor allem in ländlichen Region, wo die Kontrolle besser funktioniert als in den Städten.
"Selbst die lokalen Behörden lehnen manchmal den Bau von Gesundheitsstationen ab, vor allem wenn sie muslimisch dominiert sind", klagt Abraham. Das passiere auch dann immer wieder, wenn die einzelnen Gemeinden vor Ort sich interessiert zeigten. Eine Rolle spiele oft aber auch die Unwilligkeit der örtlichen Verwaltungen, ihren Teil zu einer Basisgesundheitsstation beizutragen und etwa eine Krankenschwester zu bezahlen.
MISSTRAUEN AUF ALLEN EBENEN ENTGEGENWIRKEN
Wie weit das gehen kann, aber auch wie massiv das Misstrauen schon ist, zeigt ein Beispiel: Die Bundesstaaten Kano, Kaduna und Zamfara verweigerten ihre Kooperation in einer Polio-Impfkampagne (Schluckimpfung) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Begründung: Der Impfstoff sei verunreinigt und diene dazu, HIV zu verbreiten und die Geimpften unfruchtbar zu machen. Nach der Intervention des nigerianischen Präsidenten Olusegun Obasanjo, der selbst Moslem ist, erklärten sich Kaduna und Zamfara im Frühjahr diesen Jahres bereit, die Aktion mitzutragen. Der Bundesstaat Kano weigerte sich weiterhin und verlangte, den Impfstoff aus Indien zu importieren.
Erheblichen Schwierigkeiten sehen sich Christen vor allem dann gegenüber, wenn sie Kirchen errichten wollen. In solchen Fällen weigern sich die muslimischen Würdenträger meist schlichtweg, Grundstücke bereit zu stellen. "Zwar ist Grundbesitz vor allem in ländlichen Regionen immer noch unüblich", erklärt Abraham. "Aber die muslimischen Würdenträger kontrollieren die Verteilung des Landes. Obwohl sie offiziell betonen, dass das Land Gott gehöre, müssen christliche Gemeindeglieder Grundbesitz privat erwerben, damit eine Kirche errichtet werden kann."
Die letzten, religiös motivierten Unruhen auf dem Jos-Plateau fanden am 26. Februar 2004 statt, als bewaffnete islamische Radikale in einer Kleinstadt namens Yelwa mindestens 48 Menschen umbrachten. Es handelte sich um einen Racheakt, nachdem eine Woche zuvor 10 Menschen bei Unruhen in einem muslimischen Dorf nahe Yelwa getötet worden waren. Nicht vergessen ist auch das fürchterliche, eine Woche andauernde Massaker vom September 2001, in dessen Verlauf in Jos über 1000 Menschen starben. Religiös und ethnisch motivierte Gewalt ist aber nicht auf Zentralnigeria beschränkt. Niemand hat die Toten je wirklich gezählt, aber seit dem Amtsantritt der demokratisch gewählten Regierung im Jahr 1999 sind in Nigeria Zehntausende von Menschen bei Unruhen umgekommen.
Interreligiöse Dialoge finden daher auf allen Ebenen statt. Auf nationaler Ebene wurde ein Interreligiöses Komitee von der Regierung initiiert, das sich in etwa halbjährlichem Turnus trifft. Wichtiger für die Versöhnung und Friedenserhaltung vor Ort sind aber sicherlich die vielen interreligiösen Institutionen in den meisten Bundesstaaten und die unzähligen Initiativen in vielen Gemeinden. "Es ist eine schwierige Arbeit", meint Abraham. "Aber die Hoffnungen aller gläubigen Menschen auf dem Plateau ruhen nicht zuletzt auf dem Forum für Frieden und Versöhnung (Peace and Reconciliation Forum), das sich seit 2001 darauf konzentriert, religiöse Führer überall dahin zu entsenden, wo es Unruhen gegeben hat, oder wo die Lage angespannt ist." Deren Autorität habe schon manchen Konflikt schlichten geholfen.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ist freier Journalist in Königswinter
Fotos: Uwe Kerkow