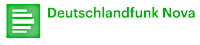Rio de Janeiro (epo). - Die Ureinwohner kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch um ihre Identität: 500 Jahre nach der Entdeckung Brasiliens durch den portugiesischen Seefahrer Pedro Alvares Cabral ist ihre Existenz ohne finanzielle und politische Abhängigkeit von der sogenannten Zivilisation unvorstellbar. Die Ausweisung von Reservaten ist lediglich der erste Schritt zur Bewahrung der vielfältigen indianischen Kultur. In Wirklichkeit geht es darum, im neuen Jahrtausend eine Nische der Toleranz im heutigen Brasilien zu finden, wo steinzeitliche Lebensformen und computergesteuerte Informationstechnologie gleichzeitig nebeneinander existieren können.
Rio de Janeiro (epo). - Die Ureinwohner kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch um ihre Identität: 500 Jahre nach der Entdeckung Brasiliens durch den portugiesischen Seefahrer Pedro Alvares Cabral ist ihre Existenz ohne finanzielle und politische Abhängigkeit von der sogenannten Zivilisation unvorstellbar. Die Ausweisung von Reservaten ist lediglich der erste Schritt zur Bewahrung der vielfältigen indianischen Kultur. In Wirklichkeit geht es darum, im neuen Jahrtausend eine Nische der Toleranz im heutigen Brasilien zu finden, wo steinzeitliche Lebensformen und computergesteuerte Informationstechnologie gleichzeitig nebeneinander existieren können.
Das Kreuz ist 17 Meter hoch und wiegt 1500 Kilogramm. Mühsam richtet ein Kran den Koloss aus Stahl auf. In der sengenden Mittagssonne verankern Arbeiter die Drahtseile in der Erde. Misstrauisch werden sie aus gebührender Entfernung von einigen Indianern beobachtet. Vor wenigen Tagen, am 26. April, wurde hier, im Reservat "Rote Krone" (Coroa Vermelha) der Patax?-Indianer, eine Messe zur Erinnerung an Pedro Alvares Cabral gelesen. Der portugiesische Seefahrer hatte an eben dieser Stelle auf den Tag genau vor 500 Jahren um den Segen Gottes bei der Entdeckung dieses neuen Landstückes mit dem Namen Brasilien gebeten.
Die Ureinwohner feierten nicht mit. Sie erinnern sich nicht gerne an Cabral, der am 22. April 1500 an ihrem Strand im Süden des Bundesstaates Bahia an Land ging. "Was soll dieses teure, gigantische Kreuz in unserer verarmten Siedlung?", fragt Gerson Patax? Ha Ha hae, Häuptling der Siedlung Caramuru im Reservat. Er versteht nicht, warum Brasiliens Präsident Fernando Henrique Cardoso die Ureinwohner bei der offiziellen Jubiläumsfeier als "phantastischen anthropologischen Reichtum" pries, aber dennoch ein Kreuz errichten ließ.

Sind die Ureinwohner Brasiliens 500 Jahre nach der Ankunft der portugiesischen Seefahrer zu "kultivierten Eingeborenen mit christlicher Ethik" geworden, wie es der französische Ethnologe Claude L?vi-Strauss 1994 in seinem "Brasilianischen Album" formulierte? Der französische Ethnologe hatte bereits zwischen 1935 und 1939 das Amazonasgebiet bereist und schon damals in dem berühmten Werk "Traurige Tropen" über die Zerstörung von ehemals hochentwickelten indianischen Kulturen im Inneren Brasiliens berichtet.
Nicht nur für die Patax? waren die Folgen der ersten Begegnung mit dem "weißen Mann" vor 500 Jahren unvorhersehbar und verhängnisvoll. Die Konfrontation mit den portugiesischen Glücksrittern macht Brasiliens Ureinwohnern bis heute zu schaffen. Allein in jüngster Zeit wurden große Teile der Yanomami durch die von den Goldsuchern mitgebrachten Krankheiten dahingerafft und verloren ihre Nahrungsgrundlage durch die mit Quecksilber verseuchten Flüsse. Der Stamm der Kaiow? in Mato Grosso do Sul wird seit Jahren durch eine Selbstmordwelle erschüttert. Und die Korubo im Amazonas dringen immer tiefer in den Regenwald ein, um vor Drogenhändlern zu fliehen, die heimliche Landepisten in ihrem Gebiet anlegen.
Claude L?vi-Strauss gelangte Ende der 80er Jahre bei einem Besuch in der brasilianischen Metropole Sao Paulo zu der niederschmetternden Erkenntnis, daß "wir, die Menschen, kulturell enteignet und der Reinheit von Wasser und Luft, der Wohltaten der Natur und der Vielzahl und Verschiedenheit der Tier- und Pflanzenarten beraubt, fortan alle Indianer sind. Wir sind im Begriff, uns selbst zu dem zu machen, was wir aus ihnen gemacht haben." In einer merkwürdigen Umkehrung würden viele Indianer, die heute zwischen Alkoholismus und Krankheiten aufgerieben werden, über ihre Mythen, Zeremonien und Sprachen in den Schulen der Missionsstationen unterrichtet.
Die kulturpessimistischen Provokationen des französischen Professors lösten weltweit Betroffenheit aus. Die "Traurigen Tropen" sollten wieder fröhlich werden, forderten Umweltschützer und gewannen zunehmend Unterstützung. Auf der UNO-Umweltkonferenz 1992 in Rio rauchte der damalige Generalsekretär Maurice Strong im Schneidersitz die Friedenspfeife und feierte die Ureinwohner Lateinamerikas als Umweltexperten und Schützer des Regenwaldes. "Wenn wir die Indianer wieder entdecken, können wir die Grundsteine für eine gerechtere Zukunft legen", versicherte er.
Fast alle 160 Millionen Einwohner Brasiliens stammen von den Indios ab - so lauten die Ergebnisse jüngster historischer Forschungen. "Vor der Heirat wurden die Indianerinnen getauft und bekamen einen europäischen Namen, deswegen sind die Spuren der Vermischung so schwer zu verfolgen", schreibt die Historikerin Maria Beatriz Nizza da Silva. Doch ohne das Zusammenleben mit den Indios hätten die Portugiesen in der Neuen Welt nicht überleben können. Der brasilianische Schriftsteller Darcy Ribeiro sieht in der "erzwungenen Verschmelzung von Indianerinnen und Eroberern die Ursache allen Übels": "Die Nachkommen haben ihre Herkunft verleugnet und sich nie zum Volk ihrer Mütter bekannt", so Ribeiro. Dadurch hätten sie ihre Identität verloren und seien zu den schlimmsten Unterdrückern der Indios geworden.

Auch über die Anzahl und die Kultur der Indianer, die das brasilianische Territorium im 16. Jahrhundert besiedelten, ist unter den Historikern einer neuer Streit ausgebrochen. Schon jetzt schwanken die Zahlenangaben zwischen zwei und sechs Millionen Ureinwohnern. L?vi-Strauss ist davon überzeugt, dass "die Völker in Zentralbrasilien wesentlich zahlreicher waren" und stützt sich dabei auf Chronistenberichte. "Es waren ihrer so viele, dass ein aufs Geratewohl in die Luft geschossener Pfeil mit Sicherheit irgend jemanden auf den Kopf gefallen wäre," berichtet der Chronist einer spanischen Expedition, die sich im Jahr 1541 auf dem Amazonas verirrt hatte. Bei ihren Beutezügen verschafften sich die Kolonisatoren laut Bericht "Lebensmittelvorräte, die eine Truppe von tausend Mann ein ganzes Jahr lang ausreichend verproviantiert hätte."
Erst in jüngster Zeit wird die offizielle Geschichte der Besiedlung des amerikanischen Kontinents verstärkt in Frage gestellt. "Es war für das europäische Gewissen bequemer und beruhigender, solche Beschreibungen der Prahlerei der Abenteurer zuzuschreiben, als mit der Elle ihrer Berichte das ganze Ausmaß der Massaker zu messen", ist L?vi-Strauss überzeugt. In Wirklichkeit seien die Indianer, die heutzutage vielfach das Bild einer primitiven Menschheit böten, Überreste höherer und zahlreicherer Zivilisationen, deren untrügliche Spuren nun mit modernsten Techniken ausgerüstete Archäologen am Amazonas ausmachten.
Dass Brasiliens Ureinwohner den "wahrhaft monströsen Genozid, den die Portgugiesen vom Atlantik bis zum Amazonas begangen haben" (L?vi-Strauss) überhaupt überlebt haben, kommt einem Wunder gleich. Rund 330 000 Indios leben heute in Brasilien, die überwiegende Mehrheit von ihnen im Amazonasgebiet. Die 210 ethnisch unterschiedlichen Völker umfassen eine Vielfalt von 170 Sprachen. "Eigentlich hätte es im neuen Jahrtausend in Brasilien keine Indianer mehr geben sollen", erklärte Dom Apparecido Jos? Dias vom katholischen Indianermissionsrat "Cimi". Für das Jahr 1998 sei mit dem endgültigen Aussterben der indianischen Bevölkerung gerechnet worden.
Die offiziellen Hochrechnungen stützten sich dabei auf die bisherige Geschwindigkeit des Bevölkerungsschwundes. Von den sechs Millionen Indios, die angeblich zur Zeit der Ankunft der portugiesischen Kolonisatoren gelebt haben sollen, seien im Jahr 1822 noch 600.000 übriggeblieben. 1889 wurden noch 300.000 Ureinwohner gezählt, 1967 wurde ihre Zahl mit 100.000 Menschen angegeben. 1978 schrumpfte ihre Zahl auf 20.000. "Statt definitiv dem Genozid zu erliegen, haben die Völker begonnen, ihre Gebiete und ihre Identität zurück zu erobern", konstatieren "Cimi"-Vertreter.
Damit die kommenden 500 Jahre "anders werden", wirbt die Kampagne "500 Jahre Widerstand der Indios, der Schwarzen und der Volksbewegungen" verstärkt um Solidarität bei den eigenen Landsleuten. Mit Unterstützung von "Cimi" sammelten ihre Anhänger auf einer Konferenz vom 18. bis 21. April in Coroa Vermelha Vorschläge für eine gerechtere Gesellschaft. "Wir, die Indianer, die Landlosen, die Obdachlosen, Straßenkinder, Sklavenarbeiter und Arbeitslosen werden dieses System, das uns unterdrückt, verändern" hat sich die Bewegung auf die Fahnen geschrieben.
Doch worin besteht die Identität von Indios, die ihre Sprache verlernt haben, mit Funktelefonen und Transistorradios umgehen und Geld durch den Verkauf von traditionellem Federschmuck verdienen? Was haben sie außer ihrer Armut mit den Nachfahren afrikanischer Sklaven gemein? Fühlen sie sich den Bräuchen ihrer Ahnen wirklich noch verbunden? Was haben sie mit den schätzungsweise 900 isoliertem Indios gemein, die heute noch verstreut in 50 Gruppen in den hintersten und unzugänglichsten Winkeln des Regenwaldes leben? Wer gilt in der heutigen Gesellschaft Brasiliens überhaupt als Indio?
"Indios sind all jene Individuen, die sich als solche identifizieren, die von den Mitgliedern ihres Stammes oder ihrer Dorfgemeinschaft als Angehörige anerkannt werden und die langjährige Verbindungen zu Bevölkerungen vor der Zeit Kolumbus pflegen," heißt es in der Definition der anerkannten Nichtregierungsorganisation "Instituto Socioambiental" (ISA) aus Sao Paulo. Über ein Rezept für ein friedliches Miteinander zwischen Indios und "zivilisierten" Brasilianern verfügen allerdings weder die brasilianische Regierung, noch die Umweltschützer und auch nicht die Indianer selbst. "Die Zukunft der Indios ist unsicher", heißt es in einer vom ISA anläßlich des 500jährigen Jubiläums Brasiliens herausgegebenen Zusammenfassung über die indigene Bevölkerung. Doch nachdem die These vom Aussterben der Ureinwohner sich als falsch erwiesen habe, hinge die Zukunft der Indios in erster Linie von ihnen selber ab. Sie müßten eine Nische bei den zukunftsorientierten Projekten in Brasilien finden und seien dabei auf die Unterstützung des Staates und der Gesellschaft angewiesen.
Dass es daran manchmal hapert, räumen Vertreter von Brasiliens Indianerschutzbehörde Funai offen ein. "Das Recht auf kulturelle Eigenständigkeit und der Schutz der traditionellen Gebiete werden in der Praxis nicht respektiert", erklärt Sydney Possuelo, Leiter der Abteilung für isolierte Indianerstämme in der Funai. Statt dessen würde die alte Politik der Assimilierung und Bevormundung weiter betrieben, meint er selbstkritisch. An ihm liegt es nicht. Als Chef der Funai sorgte Possuelo bereits 1991 dafür, dass die Goldgräber aus dem Reservat der Yanomami herausgeflogen wurden und ihnen die Rückkehr verwehrt wurde. Heute handelt er sich für seinen kompromisslosen Einsatz zugunsten der noch isoliert lebenden Indianerstämme Todesdrohungen und Feindschaften ein.
Eigentlich sollten bis zum Jahr 1993 alle 561 offiziell anerkannten Indianergebiete ausgewiesen und abgegrenzt sein. Die Fläche macht insgesamt 10,87 Prozent des brasilianischen Staatsgebietes aus, was umgerechnet 929.000 Quadratkilometern entspricht (Zum Vergleich: Die Fläche des wiedervereinigten Deutschlands beträgt 357.000 km2). Bis jetzt sind nach Angaben der brasilianischen Indianerbehörde Funai 315 Gebiete mit einer Fläche von mehr als 700 000 Quadratkilometern ausgewiesen.

Erst durch das 1992 auf dem UNO-Umweltgipfel beschlossene Pilotprogramm zur Bewahrung der tropischen Wälder kam der ins Stocken geraten Prozess der Demarkierung wieder in Gang. Insgesamt 151 Reservate sollen im Rahmen des Pilotprogramms, das mit 30 Millionen Mark ganz überwiegend von der deutschen Regierung gefördert wird, gesichert werden. Das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" begann bereits 1991 mit einem eigenen Pilotprojekt und stellte 2,1 Millionen Mark zur Vermessung des Reservats des Madija-Volkes in den Bundesstaaten Acre und Amazonas zur Verfügung.
Die Mehrheit der 17 Millionen Bewohner des Amazonasgebietes schüttelt über derartige Investitionsprogramme zugunsten von Indios nur den Kopf. Sie verstehen nicht, "dass so wenige Indianer so viel Land bekommen". Denn nicht nur die Sicherung der Reservate ist aufwendig und kostspielig. Auch das von der Verfassung garantierte Alphabetisieren der Indios in ihrer eigenen Sprache und ihre gesundheitliche Versorgung kostet viel Geld.
Die Sicherung von traditionellen Indianergebieten ist deshalb nur der erste Schritt, den Ureinwohnern Brasiliens ihre traditionelle Lebensweise zu ermöglichen. Die Lebensbedingungen in der Regenwaldregion Amazonien seien schon besser, heißt es in der Bilanz der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit zum aktuellen Stand des Pilotprogramms. "Doch ohne zusätzliche dauerhafte Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, im städtischen Dienstleistungsbereich und in der Industrie wird es nicht möglich sein, Indianergebiete, Sammlerreservate oder Waldschutzzonen zu schützen."
Die Übergriffe von Goldsuchern, Holzhändlern, Viehzüchtern und Landlosen gehen auch 500 Jahre nach dem ersten Kontakt der Ureinwohner mit den Vertretern der "europäischen Zivilisation" unvermindert weiter. Im Reservat der Yanomami ist die Funai zur Zeit erneut damit beschäftigt, Scharen von Goldgräbern zu vertreiben. "Am schwierigsten wird es sein", so Sydney Possuelo, die Yanomami zu motivieren, zu ihren alten Lebensgewohnheiten zurückzukehren." Denn inzwischen sei der weiße Mann aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken.
Für Häuptling David Kopenawa ist das Gold der Grund allen Übels: "Nachdem die Weißen es ausgebuddelt und verbrannt haben, erreichte ein gefährlicher Dampf die Brust des Himmels", klagt er. "Unsere Weisen sind machtlos, die Erde wird krank". Kopenawa lebt in der Siedlung "Demini" unmittelbar in der Nähe der Grenze zu Venezuela. 1992 wurde der Häuptling für seine Verdienste um die Ureinwohner von den Vereinten Nationen mit dem Preis "Global 500" ausgezeichnet. Nach dem Glauben der Yanomami halten die religiösen Führer des Stammes mit ihren Gebeten die Geister des Himmels von Zornesausbrüchen ab. Wenn es keine Yanomami mehr gibt, bricht folglich der Himmel über allen zusammen - auch über den Weißen.
Astrid Prange
Fotos: ? Anja Kessler